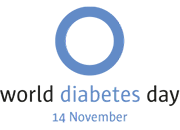Preise der Österreichischen Diabetesgesellschaft 2013
Langerhans-Preis der ÖDG 2013
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis würdigt die in den letzten fünf Jahren publizierten oder zur Publikation angenommenen Arbeiten aus dem Bereich der Diabetologie und wurde 2013 bereits zum dritten Mal vergeben. Preisträger ist Univ.-Prof. Dr. Harald Sourij (Graz) für seine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet Typ-2-Diabetes und Prädiabetes sowie deren kardiovaskuläre Komplikationen.
Das wissenschaftliche Interesse von Dr. Sourij galt bereits seit den Zeiten seines Studiums dem Diabetes mellitus Typ 2 und dem Prädiabetes sowie deren kardiovaskulären Komplikationen; weiters untersuchte er die Prävalenz postprandialer Hyperglykämien bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit. In Zusammenarbeit mit dem LKH Feldkirch konnte einerseits die koronarangiographische Morphologie bei Patienten mit postprandialer Hyperglykämie besser charakterisiert und andererseits das deutlich erhöhte kardiovaskuläre Risiko bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und postprandialer Hyperglykämie gezeigt werden.
In den folgenden Jahren führte Dr. Sourij zahlreiche kleine Interventionsstudien durch, die das Ziel hatten, den Einfluss von Antidiabetika und Antihypertensiva auf kardiovaskuläre Surrogatparametern wie endotheliale Dysfunktion bei Patienten in verschiedenen Stadien einer Glukosetoleranzstörung zu untersuchen.
Nationale und internationale Forschungstätigkeit: Seit 2008 leitet Dr. Sourij die Arbeitsgruppe für kardiovaskuläre Diabetologie an der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel der Medizinischen Universität Graz.
2010 wechselte er nach Oxford, UK, um an der Diabetes Trials Unit bei Professor Rury Holman an großen, internationalen Outcomestudien in der Diabetologie zu arbeiten. Zwischen 2011 und 2013 war er Klinischer Leiter der EXenatide Study of Cardiovascular Event Lowering (EXSCEL), eine randomisierte, kontrollierte Studie bei über 14.000 Patienten mit Typ-2-Diabetes.
2013 kehrte er als Assoziierter Professor an die Medizinische Universität Graz zurück, bleibt aber weiterhin eng mit der Diabetes Trials Unit in Oxford verbunden und fungiert aktuell als Klinischer Leiter für die TECOS-Studie.
2012 wurde er zum Robert Turner Research Associate des Green Templeton College in Oxford ernannt, wo er bis zu seiner Rückkehr nach Österreich Diabetes-Seminare abgehalten hat.
Harald Sourij ist Mitglied der Österreichischen, Britischen und Europäischen Diabetesgesellschaft, sowie Mitglied der Diabetes & Cardiovascular Disease Study Group der EASD. Er war Sekretär (2005-2007) und Vorstandsmitglied (2010-2012) der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Seit 2013 ist er Associate Editor des wissenschaftlichen Journals „Trials“.
Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Harald Sourij schloss 2004 sein Medizinstudium sub auspiciis presidentis rei publicae an der Medizinischen Universität Graz ab, wo er anschließend an der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel auch seine Facharztausbildung für Innere Medizin absolvierte und sich im Jahr 2010 habilitierte.

Preisträger Univ.-Prof. Dr. Harald Sourij (rechts) mit Prim. O. Univ.-Prof.
Dr. Dr. h. c. Heinz Drexel (Past-Präsident der ÖDG, links)
Bildnachweis: Wild und Team (Salzburg)
Abstract-Preise der ÖDG 2013
Harald Kojzar, Martina Urschitz, Barbara Lehki, Julia Mader, Markus Ehrmann, Martin Ellmerer, Thomas R. Pieber, Werner Regittnig
„Subkutane Bolusgabe mit Insulinpumpe bei Typ 1 Diabetikern – Auswirkung der Boluslänge auf die Absorptionskinetik von schnell wirksamem Insulin“
Aufgrund des erhöhten Insulinbedarfs bei Mahlzeiten müssen Insulinpumpen große Insulinmengen über relativ kurze Zeitspannen abgeben können. Diese Zeitspannen (Boluslängen) hängen von der gewählten Bolusmenge und dem Insulinpumpenmodell ab.
In dieser Studie wurde die subkutane Absorptionskinetik von Kurzzeitinsulin untersucht, das mit zwei häufig verwendeten Boluslängen (2 und 40 Sekunden pro Insulineinheit) verabreicht wurde.
Während zweier euglykämischer Clamps, die im Abstand von mindestens 7 Tagen durchgeführt wurden, erhielten 20 Typ-1-Diabetiker in randomisierter Abfolge einen subkutanen Insulinbolus (15 Einheiten Insulin Lispro, Eli Lilly) über eine Boluslänge von 30 Sekunden (kurzer Bolus mit Animas IR2020 Pumpe) und einen über eine Boluslänge von 10 Minuten (langer Bolus mit Medtronic Minimed Paradigm 512 Pumpe).
Im Vergleich zum langen Bolus führte der kurze Bolus zu einem wesentlich früheren
Einsetzen der Insulinwirkung (21,0±2,5 vs. 34,3±2,7 min; p<0,002). Außerdem trat die maximale Insulinwirkung bei kurzem Bolus um 27 Minuten früher als beim langen Bolus auf (98±11 min. vs. 125±16 min.; p<0,005). Zudem war beim kurzen Bolus die Fläche unter der Plasmainsulinkurve von 0 bis 60 min. um 26% größer als die beim langen Bolus (10307±1291 vs. 8192±865 min.pmol/L; p=0,027).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Insulinbolusgabe mit kurzer Boluslänge zu
einer wesentlich schnelleren Insulinabsorption führt als die mit langer Boluslänge. Die Ergebnisse dieser Studie können daher große Auswirkungen auf die zukünftige Gestaltung der Bolusabgabeeinheit bei Insulinpumpen haben.
Dr. Harald Kojzar ist seit 2007 als Mitarbeiter an der Medizinischen Universität Graz, Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel in der Arbeitsgruppe Prof. Dr. Pieber, auf dem Gebiet der Diabetesforschung tätig. Im Jahr 2012 schloss er sein berufsbegleitendes Studium der Molekularbiologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz mit dem Titel BSc. ab. Aktuelles Forschungsgebiet ist der Bereich Insulinpumpentherapie und Glukosemonitoring mit kontinuierlichen Glukosesensoren in Zusammenarbeit mit DI Dr. Werner Regittnig.

Dr. Harald Kojzar (links) und OA Univ. Doz. Dr. Christoph Säly, Abteilung für
Innere Medizin und Kardiologie, Landeskrankenhaus Feldkirch (rechts)
Bildnachweis: Wild und Team (Salzburg)
Tomas Jelenik, Ulrich Flögel, Kirti Kaul, Simone Zander, Katharina Bottermann, Sarah Möllendorf, Hajo Partke, Dirk Müller-Wieland, Jürgen Schrader, Axel Gödecke, Marc Merx, Malte Kelm, Michael Roden, Julia Szendrödi
„Diabetic cardiomyopathy relates to altered mitochondrial function in mice with steatosis and insulin resistance“
Nichtalkoholische Fettleber (NAFL) und Insulinresistenz sind mit einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität assoziiert. Die aktuell vorgestllte Arbeit untersuchte den Zusammenhang zwischen NAFL und Herzfunktion, Ischämietoleranz und Mitochondrienfunktion im Mausmodell. Für die Ermittlung der Insulinsensitivität wurden die Tiere Hyperinsulinämie-Euglykämie-Clamps unterzogen.
Es zeigte sich, dass die Tiere mit NAFL Insulinresistenz und Nüchtern-Hyperinsulinämie entwickelten; in der Folge kam es bei Mäusen mit NAFL häufiger zu Linksventrikel-Hypetrophie, Herzverfettung und höherem Herzauswurfvolumen als bei den Kontrolltieren ohne NAFL. Nach Myokardinfarkt kam es bei Mäusen mit NAFL zu einem deutlich stärkeren Abfall der Herzleistung. Ein erhöhter Energiebedarf und eine Substratumstellung in Richtung Lipide führte zu einem höheren Sauerstoffverbrauch und oxidativem Stress. Der erhöhte Verlust an Herzleistung legt nahe, dass ischämische Intoleranz mit einem veränderten Energiestoffwechsel zusammenhängt, der die kardiale Mortalität bei diabetischer Kardiomyopathie erhöht.
Dr. Tomas Jelenik, 1982 in der Slowakei geboren, erwarb seinen Doktortitel in Biochemie und Pathobiochemie an der Karls-Universität in Prag im Jahr 2010. Im Zuge seiner Doktorarbeit an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik beschäftigte er sich mit der Rolle der Omega-3-Fettsäuren bei der Regulierung von Adipositas und mit ihrem Einfluss auf die Beständigkeit von Insulin.
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von Prof. Michael Roden am Deutschen Diabetes Zentrum in Düsseldorf sind die aktuellen Arbeitsschwerpunkte die weitere Erforschung der lipidinduzierten Insulinbeständigkeit, die Rolle der mitochondrialen Funktionen, oxidativer Stress bei Diabetes Typ 1 und Typ 2 sowie die Erforschung der Mechanismen von diabetischer Kardiomyopathie bei Tieren und Menschen.

Dr. Tomas Jelenik
Copyright: privat
DIABETES FORUM-Preis 2013
Im Rahmen der 41. ÖDG-Jahrestagung im November 2013 wurde zum zweiten Mal der vom MedMedia Verlag unterstützte DIABETES FORUM-Preis vergeben. Prim. Univ.-Prof. Dr. Guntram Schernthaner, der Herausgeber von DIABETES FORUM, überreichte den Preis an Dr. Bianca Itariu (Wien).
Bianca Itariu, Martin Bilban, Gerhard Prager, Felix Langer, Thomas M. Stulnig
The effects of long chain n-3 PUFA supplementation on liver gene expression in severely obese patients
Zu den bekannten Wirkungen von Omega-3-Fettsäuren zählen unter anderem entzündungshemmende und lipidsenkende Effekte. Unter der Leitung von Prof. Stulnig führten Dr. Itariu und Mitarbeiter die erste Microarray-Analyse zu den Effekten von Omega-3 Fettsäuren im menschlichen Lebergewebe durch.
In einer randomisierten, kontrollierten Studie untersuchte die Arbeitsgruppe die Wirkung von langkettigen Omega-3-Fettsäuren (EPA, DHA) auf die Genexpression in der Leber von hochgradig adipösen Patienten (BMI > 40 kg/m). Dafür wurden über 20.000 Transkripte mittels einer Microarray-Analyse bei 30 Patienten ausgewertet. Nach zwei Monaten zeigte sich bei den Patienten, die mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren behandelt worden waren, eine im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant erhöhte Expression von Genen, die in Immunreaktionen sowie in den Lipid- und Kohlenhydratstoffwechsel involviert sind. Parallel dazu war die Expression von Genen, die an Entzündungsreaktionen, Triglyzeridsynthese und am Glucagon-Signalweg beteiligt sind, vermindert.
Durch diese Erkenntnisse könnten neue Schlüsselgene für die antientzündliche und lipidsenkende Wirkung von Omega-3-Fettsäuren identifiziert werden. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Omega-3-Fettsäuren auch bisher unbekannte Einflüsse auf andere Signalwege ausüben könnten. Insgesamt konnte die Studie damit einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Wirkung langkettiger Omega-3-Fettsäuren beim Menschen liefern.
Dr. Bianca Itariu schloss ihr Medizinstudium an der Medizinischen Universität Timioara, Rumänien, ab. An der Medizinischen Universität Wien absolviert Dr. Itariu als Wissenschaftsausbildung das PhD-Studium im „Endocrinology and Metabolism“-Programm (Betreuer: Prof. Dr. Thomas Stulnig, Leiter des Christian-Doppler-Labors für Kardiometabolische Immuntherapie). Seit Kurzem arbeitet Dr. Itariu an der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel der Universitätsklinik für Innere Medizin III als Assistenzärztin.

Dr. Bianca Itariu und Prim. Univ.-Prof. Dr. Guntram Schernthaner,
Herausgeber von DIABETES FORUM
Bildnachweis: Wild und Team (Salzburg)